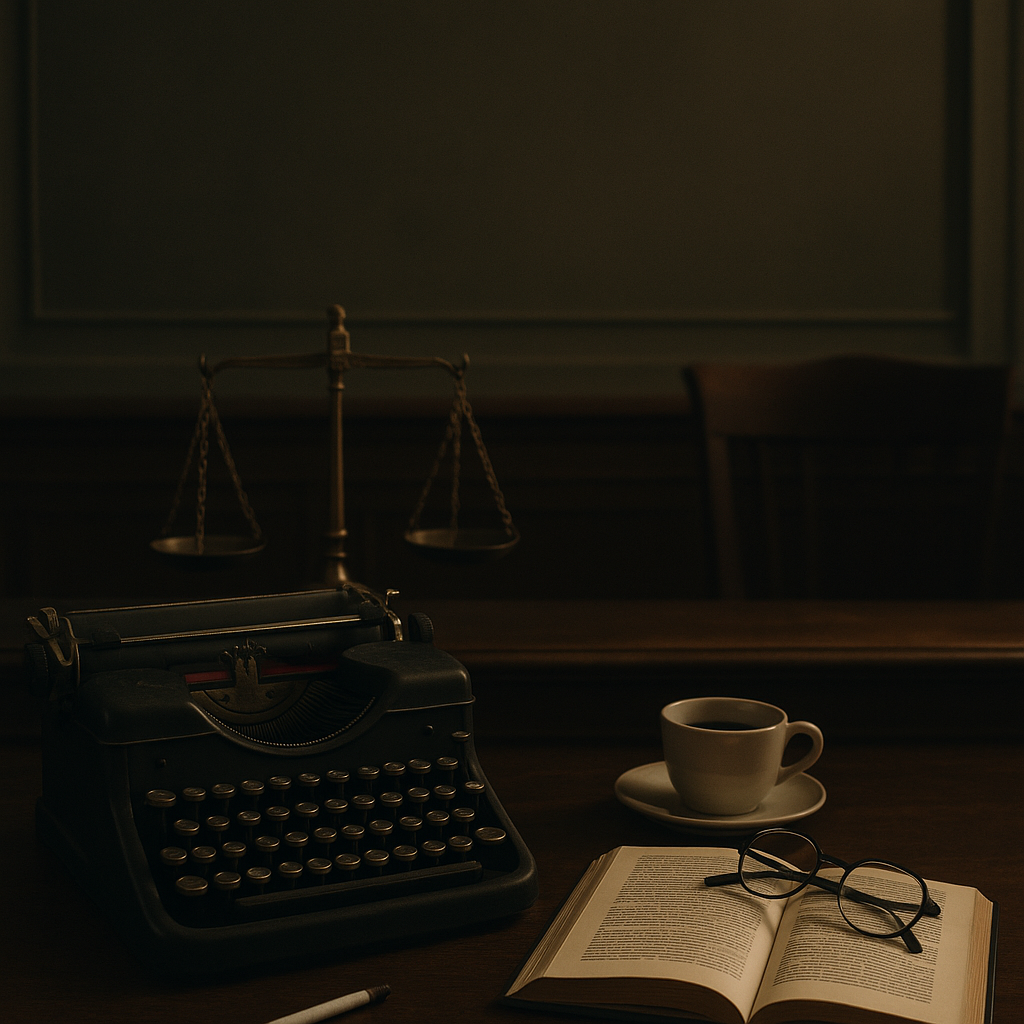Ferdinand von Schirach und die Rückkehr zum Lesen
Es war März 2020, als die Welt stillstand. In jenen seltsamen Tagen, da die Straßen leer waren und die Zeit plötzlich eine andere Qualität bekam, geschah etwas Unerwartetes: Ich begann wieder zu lesen. Nicht das hastige Überfliegen von Nachrichten oder das mechanische Abarbeiten beruflicher Lektüre – nein, ich begann wieder richtig zu lesen, mit jener Hingabe, die ich seit Jahren vermisst hatte.
Die Pandemie hatte vieles genommen, aber sie gab mir auch etwas zurück: die Verbindung zu den Büchern. In der erzwungenen Stille entdeckte ich die Literatur neu, als wäre sie ein alter Freund, den man nach langer Trennung wiedertrifft. Und in diesem Wiederentdecken stieß ich auf einen Namen, der mein Leseverhalten der kommenden Jahre prägen sollte: Ferdinand von Schirach.
Die erste Begegnung
Es begann mit einem schmalen Band: „Kaffee und Zigaretten“. Erschienen 2019, war es eines jener Bücher, die man zunächst unterschätzt. Neun Geschichten über Menschen in Grenzsituationen, erzählt mit einer Präzision, die an Skalpelle erinnert. Schirach, der Strafverteidiger aus Berlin, der zum Schriftsteller wurde, hatte eine Sprache gefunden, die mich sofort fesselte. Klar wie Bergwasser, ohne jede Sentimentalität, und doch voller Menschlichkeit.
Die Presse lobte das Buch einhellig. Die Süddeutsche Zeitung schrieb von „literarischen Miniaturen von großer Wucht“, die FAZ pries die „kühle Eleganz“ der Prosa. Aber was mich packte, war etwas anderes: die Art, wie Schirach seine Figuren betrachtete – mit der Distanz des Juristen und der Wärme des Menschen, der um die Abgründe weiß.
Nach „Kaffee und Zigaretten“ folgte ein literarischer Rausch. Ich las mich systematisch durch Schirachs Werk, chronologisch, wie ein Archäologe, der Schicht um Schicht freilegt. Da war zunächst „Verbrechen“ (2009), sein Debüt, das ihn über Nacht berühmt machte. Wahre Fälle aus seiner Anwaltspraxis, verdichtet zu literarischen Miniaturen. Die Kritik sprach von einem „neuen Ton in der deutschen Literatur“, und tatsächlich – hier war jemand, der das Grauen des Alltags in eine Sprache fasste, die zugleich sachlich und poetisch war.
Der chronologische Parcours
2010 folgte „Schuld“, wieder Geschichten aus dem Gerichtssaal, wieder diese unbestechliche Beobachtung menschlicher Verirrungen. Die Zeit schrieb, Schirach habe „das Krimigenre revolutioniert“. Aber war es überhaupt Krimi? Diese Geschichten handelten nicht von der Aufklärung von Verbrechen, sondern von der Unaufklärbarkeit des Menschen.
„Strafe“ erschien 2018 und komplettierte die Trilogie der juristischen Erzählungen. Hier zeigte sich Schirachs Reife als Erzähler. Die Welt befand, er habe „die hohe Kunst des Weglassens“ perfektioniert. Jeder Satz saß, kein Wort zu viel, kein Gefühl zu wenig.
Parallel entwickelte sich Schirach zum Theatermann. „Terror“ (2015) war mehr als nur ein Theaterstück – es war ein demokratisches Experiment. Das Publikum entschied über Schuld oder Unschuld des Protagonisten. Die Aufführungen wurden zu gesellschaftlichen Ereignissen, die Kritik feierte ein „Theater der direkten Demokratie“.
2017 brachte er mit „Die Herzlichkeit der Vernunft“ sein erstes gemeinsames Werk mit Alexander Kluge heraus. Ein Gespräch über Gerechtigkeit zwischen zwei ungleichen Geistern: dem Juristen und dem Filmemacher. Die NZZ nannte es „ein Buch der großen Fragen“. Kluge und Schirach – der eine ein Virtuose des Experiments, der andere ein Meister der Reduktion – fanden eine gemeinsame Sprache für die großen Themen unserer Zeit.
Die Prosa der Gegenwart
„Tabu“ (2013) hatte gezeigt, dass Schirach auch jenseits des Gerichtssaals erzählen konnte. Dreizehn Geschichten über Grenzen und deren Überschreitung, über das Unsagbare in scheinbar normalen Leben. Der Spiegel schrieb von „literarischen Röntgenaufnahmen der Gesellschaft“.
Mit „Sie sagt. Er sagt.“ (2020) wagte er sich an das vielleicht schwierigste aller Themen: die Beziehung zwischen Mann und Frau. Sechs Paare, zwölf Stimmen, eine Wahrheit, die es nicht gibt. Die Frankfurter Rundschau sprach von einem „Meisterwerk der Mehrdeutigkeit“.
„Nachmittage“ (2022) und „Regen“ (2023) zeigten einen anderen Schirach. Nachdenklicher, melancholischer vielleicht. Hier war der Jurist ganz zum Literaten geworden, der nicht mehr Fälle erzählt, sondern Stimmungen einfängt. Die SZ schrieb, Schirach habe „die Poesie des Gewöhnlichen“ entdeckt.
Hemingway als Leitfigur
Was mich an Schirach besonders faszinierte, war seine Liebe zu Ernest Hemingway. Wie ich ist er ein glühender Verehrer des amerikanischen Meisters. In einem Interview sagte Schirach einmal: „Hemingway hat mir gezeigt, dass man mit wenigen Worten alles sagen kann. Seine Sätze sind wie Messerstiche – präzise und tödlich.“ Diese Präzision, diese Kunst des Weglassens, findet sich in jedem Text Schirachs.
Über Hemingways „Der alte Mann und das Meer“ schrieb Schirach: „Es ist das perfekte Buch. Kein Wort zu viel, kein Wort zu wenig. Hemingway erzählt die Geschichte eines Fischers und meint das Leben selbst.“ Diese Haltung – das Große im Kleinen zu finden, das Universelle im Besonderen – durchzieht auch Schirachs eigenes Werk.
Beide Autoren verbindet die Fähigkeit, mit scheinbar einfachen Mitteln komplexe Wahrheiten zu vermitteln. Hemingways Eisberg-Theorie – dass nur ein Achtel der Geschichte an der Oberfläche sichtbar sein sollte – findet sich in Schirachs juristischen Miniaturen wieder. Was nicht gesagt wird, ist oft wichtiger als das Gesagte.
Das universelle Werk
„Jeder Mensch“ (2021) war Schirachs politischstes Buch. Sechs Geschichten über die Europäische Grundrechtecharta, die er mitentworfen hatte. Hier zeigte sich der Jurist als Visionär, der Pragmatiker als Idealist. Die Zeit schrieb, Schirach habe „ein Manifest der Menschlichkeit“ geschrieben. Tatsächlich war es mehr: ein Plädoyer für eine bessere Welt, formuliert in jener klaren Sprache, die Schirach zum Markenzeichen geworden ist.
2022 folgte „Trotzdem“, wieder ein Gespräch mit Alexander Kluge. Diesmal ging es um Widerstand und Hoffnung in schweren Zeiten. Die Corona-Pandemie hatte beide geprägt, aber während andere klagten, suchten sie nach Antworten. Die FAZ nannte es „ein Buch der Zuversicht“.
„Carl Thonberg“ (2024) schließlich war Schirachs bisher persönlichstes Werk. Die Geschichte eines Mannes, der zwischen den Welten steht – zwischen Ost und West, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Kritik sprach von einem „Alterswerk von großer Reife“, obwohl Schirach erst Anfang sechzig ist.
Die Melancholie der Klarheit
Was macht Schirachs Stil so faszinierend? Es ist diese Verbindung von juristischer Präzision und literarischer Sensibilität. Seine Sätze sind kurz, seine Worte gewählt, seine Beobachtungen scharf. Aber dahinter schwingt immer eine tiefe Melancholie mit – die Trauer über die Unvollkommenheit der Welt, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die Einsicht in die Begrenztheit menschlicher Erkenntnis.
Schirach schreibt nicht, um zu unterhalten. Er schreibt, um zu verstehen. Seine Geschichten sind Untersuchungen, seine Romane Gutachten über den Zustand der Welt. Und doch ist da immer auch Schönheit – in der Präzision der Sprache, in der Klarheit der Gedanken, in der Würde, mit der er auch die scheiternden Figuren betrachtet.
Die Wiederentdeckung des Lesens
In den Jahren seit jener ersten Begegnung mit „Kaffee und Zigaretten“ ist das Lesen wieder zu einem meiner liebsten Zeitvertreibe geworden. Nicht nur Schirach – auch andere Stimmen haben mich begleitet. Reiner Kunze, dessen Gedichte wie Kristalle in der Sprache funkeln. Die großen Toten: Thomas Mann mit seiner orchestralen Prosa, Thomas Bernhard mit seinem wütenden Gesang, Schiller und Goethe als die Säulen unserer Literatur, Heinrich Heine mit seinem Witz und seiner Bitterkeit, Albert Camus mit seiner absurden Klarheit.
Aber Schirach bleibt besonders. Vielleicht weil er ein Zeitgenosse ist, weil seine Geschichten in unserer Welt spielen, weil seine Fragen unsere Fragen sind. Er gehört zu jenen seltenen Autoren, die das Heute verstehen und in Worte fassen können, ohne dabei die großen, zeitlosen Themen aus den Augen zu verlieren.
Die Vorfreude
Am 27. August – also in knapp einer Woche – erscheint Schirachs neues Werk: „Der stille Freund“. Wieder eine Sammlung von Geschichten, wieder Beobachtungen aus einer Welt, die zunehmend aus den Fugen gerät. Die Vorankündigungen sprechen von „Geschichten über Einsamkeit und Verbundenheit“, von „Porträts einer Zeit im Umbruch“.
Ich warte sehnsüchtig darauf. Nicht nur, weil Schirach einer meiner Lieblingsautoren geworden ist, sondern weil ich weiß: Seine Geschichten werden mir wieder zeigen, was Literatur vermag – uns zu erklären, wer wir sind und wo wir stehen. In einer Zeit, in der die Welt immer lauter und unübersichtlicher wird, brauchen wir Stimmen wie die seine: klar, ruhig, wahrhaftig.
Die Corona-Jahre haben mir etwas zurückgegeben, was ich lange vermisst hatte: die Lust am Lesen, die Freude am Wort, die Sehnsucht nach Geschichten. Ferdinand von Schirach war der Schlüssel zu dieser Wiederentdeckung. Dafür bin ich ihm dankbar – und gespannt auf alles, was noch kommen wird.
Sapere aude!
S. Noir